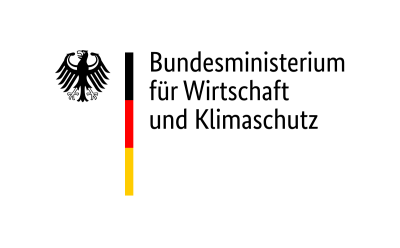Hossein Haghverdi
Schnellzugriff
Laufzeit:
08/2023 – 07/2026
Projektteam:
Hossein Haghverdi,
Prof. Dr. Mark Varrelmann
Abteilung:
Förderung:
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Kooperation(en):
Universität Hohenheim, Integrative Infektionsbiologie Nutzpflanze - Nutztier (R. Toth, M. Kube), Gemeinschaft zur Förderung von Pflanzeninnovation e. V. (GFPi), KWS SAAT SE, MariboHilleshög, SESVanderHave und Strube Research GmbH & Co.
Einführung
Das „Syndrome des basses richesses“ (SBR) gefährdet den Zuckerrübenanbau in Deutschland und Europa. Die Krankheit hat ihren Ursprung in Frankreich, wo sie in den 1990er Jahren in der Region Burgund zuerst auftrat, und dort zu größeren wirtschaftlichen Verlusten führte. Die Erkrankung wird durch das γ-Proteobakterium ‘Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus’ (ARSEPH) verursacht. In Südosteuropa sind zudem auch Phytoplasmosen für bereits bedeutende Ertragseinbußen verantwortlich (insbes. ‘Candidatus Phytoplasma solani’). In Deutschland traten sie bisher nur sporadisch auf, dominieren bereits jedoch bei den Bakteriosen in Abhängigkeit von Umweltbedingungen. Die SBR-Krankheit führt zur Reduktion des Zuckergehaltes (bis zu 5% absolut) sowie des Frischmasseertrages (bis zu 25%) und damit zu desaströsen wirtschaftlichen Ertragseinbußen von bis zu 50%. Genetische Variabilität bezüglich einer ARSEPH Toleranz kann in Feldversuchen nachgewiesen werden (Foto 1). Resistenzeigenschaften wurden bisher jedoch nicht beschrieben.
SBR-Symptome
Die SBR-Symptome umfassen Chlorosen und Nekrosen an älteren Blättern, Asymmetrien am Blattneuaustrieb, sowie Nekrosen in den Leitbündeln des Rübenkörpers (Foto 2 und 3). Die pflanzlichen Reaktionen auf den Befall sind auf molekularer Ebene bisher nicht beschrieben. Das ein Source-Sink Assimilat-Transport gestört ist, erscheint plausibel, wurde jedoch bisher ebenfalls nicht untersucht. Des Weiteren kann nur vermutet werden, dass Nährstoffverteilung und der Phytohormonhaushalt beeinträchtigt sind; allesamt Prozesse, die ein funktionales Phloem benötigen.
SBR-Übertragung
ARSEPH stellt einen fakultativen Endosymbionten von PNSTLE dar, der sich zum Phytopathogen weiterentwickelt hat. Die Zikade hat ihren Lebenszyklus von Schilfgras auf Zuckerrüben und Getreide wie Winterweizen ausgeweitet. Die Adulten, wie in Foto 4 gezeigt, ernähren sich im Sommer durch Saugtätigkeit an Blättern der Zuckerrüben und übertragen dabei den Erreger. Die Eiablage findet an den Zuckerrübenwurzeln statt. Die dort schlüpfenden Nymphen (Fotos 5 und 6) sind bereits mit dem Erreger infiziert. Die Nymphen überwintern unterirdisch und ernähren sich von Zuckerrübenernterückständen oder Fruchtfolgepflanzen wie Winterweizen.
Projektarbeitspakete und Projektziele
Das SBR-Inf-Projekt ist eine Kooperation zwischen dem IfZ, der Universität Hohenheim und der GFPi (KWS SAAT SE, MariboHilleshög, SESVanderHave und Strube Research GmbH & Co. KG). Im Projekt soll die genetische Erregerdiversität in deutschen und europäische Anbauregionen bestimmt werden. Weiterhin soll ein Infektionstest unter kontrollierten Umweltbedingungen entwickelt werden, um damit die genotypische Variation bei der Pathogenbesiedlung wie Toleranz-/Resistenzeigenschaften abzubilden. Durch gezielte Variation von Umweltfaktoren wie Temperatur und Wasserverfügbarkeit soll der Test weiter optimiert werden. Um den Züchtungsunternehmen zukünftig die Identifikation von Resistenzfaktoren zu erleichtern, sollen über eine Transkriptomanalyse die Gene und damit die biologischen Prozesse, die durch das Pathogen umprogrammiert werden, wie auch schnelle pflanzliche Abwehrreaktionen identifiziert und anschließend validiert werden.
Kooperationspartner





Förderung
Das Projekt wird im Rahmen eines Forschungsvorhabens finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, Projektträger ist DLR (DLR-PT).